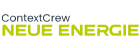Ein Gesamtvolumen von 32 Mio. €, 19 Mio. € davon Fördergelder des Bundeswirtschaftsministeriums – das sind die Eckdaten des jetzt gestarteten Projekts „MethQuest“, das sich der Erzeugung und dem Einsatz methanbasierter Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen widmet. Im Kern geht es in dem auf drei Jahre angelegten Projekt um das Thema Sektorkopplung: Wie kann regenerativ erzeugter […]
Start Nachrichten Forschung Sektorkopplung mit Power-to-Gas: BMWi fördert Projekt „MethQuest“ mit 19 Mio. €