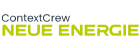Wirtschaftliche Weiterbetriebskonzepte für Post-EEG-Windenergieanlagen: An entsprechenden Lösungen arbeitet das Unternehmen Freqcon, einer der führenden Hersteller von Frequenzumrichtern und Regelungssystemen für Erneuerbaren-Anlagen. „Die neuen Wertschöpfungskonzepte basieren darauf, dass der Grüne Strom besser verkauft werden kann als dies mit den aktuellen PPA-Vermarktungsvereinbarungen möglich ist“, heißt es bei Freqcon. Bei den entwickelten Betriebsmodellen fielen keine Ausfallzeiten durch Überkapazitätsabschaltungen […]
Start Nachrichten Wirtschaft Jenseits von PPA: Intelligente Konfiguration bietet wirtschaftliche Post-EEG-Optionen